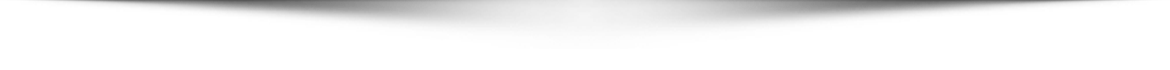Äthiopisches Reich
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Äthiopische Reich, auch bekannt als Abessinien, im heutigen Äthiopien und Eritrea, bestand von etwa 1270 (Beginn der Salomoniden-Dynastie) bis 1974, als die Monarchie durch einen Staatsstreich gestürzt wurde. Zuvor blühte in der Region das Aksumitische Reich, das sich vom vierten Jahrhundert v. Chr. bis zum zehnten Jahrhundert v. Chr. erstreckte. Danach herrschte die Zagwe-Dynastie bis 1270, als sie von der salomonischen Dynastie gestürzt wurde. Äthiopien ist einer der ältesten Staaten der Welt und die einzige afrikanische Nation, die dem Kampf der Kolonialmächte um Afrika im 19. Jahrhundert erfolgreich widerstanden hat und nur von 1935 bis zu ihrer Befreiung im Zweiten Weltkrieg kurzzeitig der italienischen Besatzung unterlag. Im Jahr 1896 fügten die Äthiopier der einmarschierenden italienischen Armee eine Niederlage zu, deren Gebietserwerb sich auf Eritrea beschränkte, dem sie das italienische Somaliland hinzufügten. Als Heimat einer alten afrikanischen christlichen Kirche und mit einer kontinuierlichen Zivilisation und kulturellen Traditionen, die Jahrtausende zurückreichen, wurde Äthiopien (das in der Bibel etwa 50 Mal erwähnt wird) für versklavte Afrikaner und ihre Nachkommen in den USA zu einem Symbol des schwarzen Stolzes und der schwarzen Würde.
Im zwanzigsten Jahrhundert erlangte der letzte Kaiser von Äthiopien für viele Menschen afrikanischer Abstammung eine besondere Bedeutung als Messias, der sie zur Freiheit von Unterdrückung führen würde. Entgegen dem europäisch-nordamerikanischen Klischee, dass Afrika keine eigenen Zivilisationen besaß und für seinen Fortschritt und seine Entwicklung der überwachenden, helfenden Hand der Kolonialmächte bedurfte, gab es hier zumindest ein Beispiel für einen alten Nationalstaat, der, wenn auch nicht in seiner heutigen verfassungsmäßigen Form, vielen europäischen Staaten vorausging. Es waren jedoch der Stolz auf seine Abstammung und seine autokratische Gesinnung, die zum Sturz des letzten Kaisers führten. Er hatte sich auf eine konstitutionelle Monarchie zubewegt, aber seine offensichtliche Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid, das durch die Hungersnot zwischen 1972 und 1974 verursacht wurde, führte zu einem marxistischen Staatsstreich.
Frühgeschichte
Die menschliche Besiedlung Äthiopiens ist sehr alt, da die frühesten Vorfahren der menschlichen Spezies entdeckt wurden. Zusammen mit Eritrea und dem südöstlichen Teil der Rotmeerküste des Sudan gilt es als der wahrscheinlichste Standort des Landes, das den alten Ägyptern als Punt bekannt war und dessen erste Erwähnung auf das fünfundzwanzigste Jahrhundert v. Chr. datiert wird. Die Anfänge eines Staates waren in dem Gebiet, das zu Abessinien werden sollte, um 980 v. Chr. erkennbar, was auch als legendäres Gründungsdatum gilt. Dieses Datum hat möglicherweise mehr mit der dynastischen Abstammung als mit der tatsächlichen Gründung eines Staates zu tun.
Zagwe-Dynastie
Die Zagwe-Dynastie regierte Äthiopien vom Ende des Königreichs Axum zu einem ungewissen Zeitpunkt im neunten oder zehnten Jahrhundert bis 1270, als Yekuno Amlak den letzten Zagwe-König in einer Schlacht besiegte und tötete. Man nimmt an, dass der Name der Dynastie von dem Ge’ez-Ausdruck Ze-Agaw stammt, was „von Agaw“ bedeutet und sich auf das Volk der Agaw bezieht. Ihr bekanntester König war Gebre Mesqel Lalibela, dem die in den Fels gehauenen Kirchen von Lalibela zugeschrieben werden. Das heutige Eritrea wurde 710 von den Umayyaden erobert, aber traditionell galt Äthiopien aufgrund der Gastfreundschaft, die die Muslime dort zu Lebzeiten Mohammeds genossen hatten, als von muslimischen Angriffen verschont. Dies mag es dem Königreich ermöglicht haben, als christlicher Staat inmitten muslimischer Staaten zu überleben.
David Buxton hat festgestellt, dass das Gebiet unter der direkten Herrschaft der Zagwe-Könige „wahrscheinlich das Hochland des heutigen Eritrea und das gesamte Tigrai umfasste, das sich nach Süden bis Waag, Lasta und Damot (Provinz Wallo) und von dort nach Westen bis zum Tana-See (Beghemdir) erstreckte.“ Im Gegensatz zur Praxis späterer Herrscher Äthiopiens argumentiert Taddesse Tamrat, dass unter der Zagwe-Dynastie die Reihenfolge der Nachfolge diejenige war, dass der Bruder auf den Bruder als König folgte, basierend auf den Agaw-Gesetzen der Vererbung.
Geschichte
Die Anzahl der Könige der Zagwe-Dynastie ist unsicher: Äthiopische Königslisten nennen zwischen fünf und 16 Namen, die zu dieser Dynastie gehörten und insgesamt entweder 133 oder 333 Jahre regierten (andere Möglichkeiten sind 137 Jahre, 250 Jahre und 373 Jahre). Alle stimmen darin überein, dass der Gründerkönig Mara Takla Haymanot war, der Schwiegersohn des letzten Königs von Axum, Dil Na’od. Der Name des letzten Königs dieser Dynastie ist jedoch verloren gegangen – die überlieferten Chroniken und mündlichen Überlieferungen geben seinen Namen als Za-Ilmaknun an, was eindeutig ein Pseudonym ist (Taddesse Tamrat übersetzt es als „Der Unbekannte, der Verborgene“), das kurz nach seiner Herrschaft von der siegreichen salomonischen Dynastie in einem Akt der damnatio memoriae verwendet wurde. Taddesse Tamrat glaubt, dass dieser letzte Herrscher eigentlich Yetbarak war.
Der äthiopische Historiker Taddesse Tamrat folgt den Theorien von Carlo Conti Rossini über diese Gruppe von Herrschern. Conti Rossini hielt die kürzere Dauer dieser Dynastie für wahrscheinlicher, da sie zu seiner Theorie passte, dass ein Brief, den der Patriarch von Alexandria Johannes V. von einem ungenannten äthiopischen Monarchen erhielt, der um einen neuen Abuna bat, weil der derzeitige Amtsinhaber zu alt war, von Mara Takla Haymanot stammte, der den Abuna ersetzt haben wollte, weil er die neue Dynastie nicht gutheißen würde.
Dynastie der Salomoniden
Im Jahr 1270 wurde die Zagwe-Dynastie von einem König gestürzt, der die Abstammung von den Aksumitischen Kaisern und damit die von Salomon behauptete (daher der Name „Salomoniden“). Die salomonische Dynastie wurde von den Habesha geboren und regiert, von denen Abessinien seinen Namen hat. Die salomonische Dynastie ist das traditionelle Königshaus Äthiopiens und behauptet, von König Salomo und der Königin von Saba abzustammen, die den traditionellen ersten König Menelik I. nach ihrem biblisch beschriebenen Besuch bei Salomo in Jerusalem zur Welt gebracht haben soll. (Altes Testament der Heiligen Bibel, Erstes Buch der Könige, Kapitel 10, Verse 1-10)
Die Dynastie, eine Bastion des äthiopisch-orthodoxen Christentums, übernahm die Herrschaft in Äthiopien am 10 Nehasé 1262 EG (10. August 1270), als Yekuno Amlak den letzten Herrscher der Zagwe-Dynastie stürzte. Yekuno Amlak beanspruchte die direkte männliche Abstammung vom alten axumitischen Königshaus, das die Zagwe auf dem Thron ersetzt hatten. Menelik II. und später seine Tochter Zewditu waren die letzten äthiopischen Monarchen, die eine ununterbrochene direkte männliche Abstammung von König Salomon und der Königin von Saba geltend machen konnten (sowohl Lij Eyasu als auch Kaiser Haile Selassie waren in der weiblichen Linie, Iyasu durch seine Mutter Shewarega Menelik und Haile Selassie durch seine Großmutter väterlicherseits, Tenagnework Sahle Selassie). Die männliche Linie, die auf die Nachkommen von Meneliks Cousin Dejazmatch Taye Gulilat zurückgeht, existierte zwar noch, war aber vor allem wegen Meneliks persönlicher Abneigung gegen diesen Zweig seiner Familie verdrängt worden. Die Salomonics regierten Äthiopien mit wenigen Unterbrechungen bis 1974, als der letzte Kaiser, Haile Selassie, abgesetzt wurde. Die königliche Familie ist derzeit nicht trächtig. Zum Zeitpunkt der Revolution von 1974 waren die Mitglieder der Familie in Äthiopien inhaftiert, andere wurden ins Exil geschickt. Die Frauen der Dynastie wurden 1989 vom Derg-Regime aus der Haft entlassen, die Männer kamen 1990 frei. Einige Mitglieder durften dann Mitte 1990 das Land verlassen, die übrigen 1991 nach dem Sturz des Derg-Regimes. Viele Mitglieder der kaiserlichen Familie sind in den letzten Jahren nach Äthiopien zurückgekehrt.
Das kaiserliche Wappen wurde von Kaiser Haile Selassie angenommen und wird derzeit von seinen direkten Erben in männlicher Linie geführt. Das Wappen besteht aus einem kaiserlichen Thron, der von zwei Engeln flankiert wird, von denen einer ein Schwert und eine Waage hält, während der andere das kaiserliche Zepter trägt. Der Thron wird häufig mit einem christlichen Kreuz, einem Davidstern und einer Mondsichel dargestellt (als Zeichen der christlichen, jüdischen und islamischen Tradition). Er wird von einem roten Mantel und einer Kaiserkrone gekrönt, und vor dem Thron befindet sich das Symbol des Löwen von Juda. Der Löwe von Juda selbst stand während der Monarchie im Mittelpunkt der dreifarbigen äthiopischen Flagge und ist somit das Hauptsymbol der äthiopischen monarchistischen Bewegung. Der Satz „Moa Ambassa ze imnegede Yehuda“ (Erobernder Löwe des Stammes Juda) erschien auf dem Wappen und war stets dem offiziellen Stil und den Titeln des Kaisers vorangestellt, bezog sich aber eher auf Christus als auf den Monarchen. Das offizielle Motto der kaiserlichen Dynastie war „Ityopia tabetsih edewiha habe Igziabiher“ (Äthiopien streckt seine Hände zum Herrn aus) aus dem Buch der Psalmen.
Wenn man die alten axumitischen Herrscher, die von Menelik I. abstammen, und die yuktanitischen Vorfahren der Königin von Saba mit einbezieht, ist das äthiopische Königshaus neben dem japanischen das älteste der Welt. Während eines Großteils der Existenz der Dynastie war ihr eigentliches Reich der nordwestliche Quadrant des heutigen Äthiopiens, das Äthiopische Hochland. Das Reich dehnte sich im Laufe der Jahrhunderte aus und verkleinerte sich wieder, wobei es manchmal Teile des heutigen Sudan und die Küstengebiete des Roten Meeres und des Golfs von Aden umfasste und sich auch nach Süden bis zum heutigen Kenia ausdehnte. Die südlichen und östlichen Regionen wurden in den letzten beiden Jahrhunderten dauerhaft eingegliedert, teils durch die Schewan-Könige, teils durch die Kaiser Menelek II. und Haile Selassie; ein Großteil der zentralen und südlichen Regionen wurde jedoch unter den Kaisern Amda Seyon I. und Zar’a Ya’iqob in das Reich eingegliedert, während die Randgebiete nach der Invasion von Ahmad Gragn verloren gingen.
Scramble for Africa and Modernization
Die 1880er Jahre waren geprägt vom „Scramble for Africa“ und der Modernisierung Äthiopiens. Konflikte mit Italien führten 1896 im Ersten Italo-Äthiopischen Krieg zur Schlacht von Adowa, in der die Äthiopier die Welt überraschten, indem sie die Kolonialmacht besiegten und unter der Herrschaft von Menelik II. unabhängig blieben. Italien und Äthiopien unterzeichneten am 26. Oktober 1896 einen vorläufigen Friedensvertrag. Der Sieg über eine europäische Armee war selten genug, wenn auch im Rahmen des Kampfes um Afrika nicht einzigartig. Die erfolgreiche Abwehr einer kolonialen Besatzung war jedoch ein Novum und damals ein schwerer Schlag für Italiens Ambitionen in der Region.
Italienische Invasion und Zweiter Weltkrieg
Im Jahr 1935 fielen italienische Soldaten unter dem Kommando von Marschall Emilio De Bono im Zweiten Italo-Äthiopischen Krieg in Äthiopien ein. Der Krieg dauerte sieben Monate, bevor ein italienischer Sieg erklärt wurde. Die Invasion wurde vom Völkerbund verurteilt, doch wie beim Zwischenfall in der Mandschurei wurde nicht viel unternommen, um die Feindseligkeit zu beenden. Äthiopien wurde Teil von Italienisch-Ostafrika, bis es 1941 von den alliierten Truppen in Nordafrika befreit wurde. 1951 wurde Eritrea, das seit 1885 zum italienischen Kolonialreich gehört hatte und von 1935 bis 1941 gemeinsam mit Äthiopien verwaltet worden war, von den Vereinten Nationen an Äthiopien abgetreten, unter der Bedingung, dass es einen Sonderstatus als autonome Provinz erhalten sollte. Im Jahr 1961 widerrief Selassie einseitig diese Vereinbarung und löste damit einen 30-jährigen Unabhängigkeitskrieg aus. Überraschenderweise entschied sich das leninistisch-marxistische Regime nach seinem Sturz für die Fortsetzung dieses Krieges, der erst 1993 mit der internationalen Anerkennung Eritreas als souveräner Staat endete. Obwohl Äthiopien von 1935 bis 1941 im Rahmen einer Kolonialverwaltung verwaltet wurde, genoss es nicht den gleichen rechtlichen Status wie andere Kolonien in Afrika, da es vom Völkerbund als illegale Besatzung betrachtet wurde, auch wenn die Mitglieder des Völkerbundes nicht auf ihre Verurteilung reagierten. Äthiopien kann immer noch als das einzige afrikanische Gebiet angesehen werden, das außerhalb des Kolonialsystems blieb. In den Jahren vor seiner Absetzung förderte der letzte Kaiser die Entkolonialisierung mit moralischer und manchmal auch materieller Unterstützung und setzte sich durch seine Beteiligung an der Organisation für Afrikanische Einheit und anderen Initiativen für die panafrikanische Einheit ein. Die OAU (gegründet 1963) hatte ihren Sitz in seiner Hauptstadt Addis Abeba, wo auch ihre Nachfolgeorganisation, die Afrikanische Union (gegründet 2002), ihren Hauptsitz hat. Selassie war der erste Vorsitzende der OAU (63-64) und hatte eine zweite Amtszeit (66-67). Auf diese Weise hat das älteste politische Gebilde Afrikas einige seiner jüngsten Einheiten zum Großvater gemacht.
Aufstieg des Derg: Ende des Kaiserreichs
Obwohl Haile Selassie das Reich (1955) zu einer konstitutionellen Monarchie mit einem gewählten Unterhaus machte, behielten der Kaiser und der Adel viele Befugnisse. Im Umgang mit Kritikern oder Gegnern seiner Politik verhielt er sich oft autokratisch, und viele Bauern hatten das Gefühl, dass sie nur wenig Einfluss auf die Regierung hatten. Als zwischen 1972 und 1974 eine große Hungersnot zu Tausenden von Toten führte, schien dem Kaiser das Leid seines Volkes gleichgültig zu sein, und er behauptete sogar, dass seine Beamten ihn nicht informiert hätten. Dieses offensichtliche Versäumnis eines absoluten Herrschers, angemessen auf eine Krise zu reagieren, die vor allem die Armen traf, trug dazu bei, marxistisch-leninistische Bestrebungen in bestimmten Teilen der Bevölkerung zu fördern. Marxistische Sympathisanten fanden ein bereitwilliges Publikum für ihre Vision eines Arbeiterparadieses, in dem Kaiser und Aristokraten keinen Platz haben. Die Hungersnot und der teure Krieg in Eritrea führten dazu, dass Ressourcen aus dem Bildungs- und Entwicklungsbereich in das Militär umgeleitet wurden.
1974 setzte eine prosowjetische marxistisch-leninistische Militärjunta, die „Derg“, unter der Führung von Mengistu Haile Mariam Haile Selassie ab und errichtete einen kommunistischen Einparteienstaat. Haile Selassie wurde inhaftiert und starb unter ungeklärten Umständen, möglicherweise, weil ihm eine medizinische Behandlung verweigert wurde. Damit war das Reich Äthiopien formell beendet und das Ende eines alten Regimes besiegelt.
Siehe auch
- Äthiopien
- Aksumitisches Reich
- Eritrischer Unabhängigkeitskrieg
- Erster Italo-Äthiopischer Krieg
Notizen
- David Buxon, The Abyssinians (New York, NY: Praeger, 1970, ISBN 978-0500020708), 44.
- A. K. Irvine, „Review: The Different Collections of Nägś Hymns in Ethiopic Literature and Their Contributions“ Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. School of Oriental and African Studies, 1985, 364-364.
- Taddesse Tamrat, Church and State in Ethiopia (Oxford, UK: Clarendon Press, 1972, ISBN 978-0198216711), 275.
- Buxon, David. The Abyssinians. New York, NY: Praeger, 1970. ISBN 978-0500020708
- Darkwah, R. H. Kofi. Shewa, Menilek, and the Ethiopian Empire, 1813-1889. London, UK: Heinemann Educational, 1975. ISBN 978-0435322182
- Donham, Donald L., und Wendy James. Die südlichen Märsche des kaiserlichen Äthiopiens: Essays in Geschichte und Sozialanthropologie. African Studies Series, 51. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1986. ISBN 978-0521322379
- Irvine, A. K. Review: The Different Collections of Nägś Hymns in Ethiopic Literature and Their Contributions. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. School of Oriental and African Studies, 1985, 364-364.
- Kapuściński, Ryszard. Der Kaiser: Untergang eines Autokraten. San Diego, CA: Harcourt Brace Jovanovich, 1983. ISBN 978-0151287710
- Mockler, Anthony. Haile Selassies Krieg: der italienisch-äthiopische Feldzug, 1935-1941. New York, NY: Random House, 1984. ISBN 978-0394542225
- Schwab, Peter. Äthiopien & Haile Selassie. New York, NY: Facts on File, 1972. ISBN 978-0871961938
- Tamrat, Taddesse. Kirche und Staat in Äthiopien. Oxford, UK: Clarendon Press, 1972. ISBN 978-0198216711
Alle Links abgerufen am 14. August 2017.
- Äthiopische Geschichte
- Äthiopien (Website der Royal Ark).
Credits
New World Encyclopedia Autoren und Redakteure haben den Wikipedia-Artikel in Übereinstimmung mit den Standards der New World Encyclopedia umgeschrieben und ergänzt. Dieser Artikel unterliegt den Bedingungen der Creative Commons CC-by-sa 3.0 Lizenz (CC-by-sa), die mit entsprechender Namensnennung genutzt und weiterverbreitet werden darf. Unter den Bedingungen dieser Lizenz, die sich sowohl auf die Mitarbeiter der New World Encyclopedia als auch auf die selbstlosen freiwilligen Mitarbeiter der Wikimedia Foundation beziehen kann, ist die Anerkennung fällig. Um diesen Artikel zu zitieren, klicken Sie hier, um eine Liste der zulässigen Zitierformate zu erhalten.Die Geschichte früherer Beiträge von Wikipedianern ist für Forscher hier zugänglich:
- Äthiopisches_Reich Geschichte
- Zagwe_Dynastie Geschichte
- Salomonische_Dynastie Geschichte
Die Geschichte dieses Artikels, seit er in die New World Encyclopedia importiert wurde:
- Geschichte des „Äthiopischen Reiches“
Hinweis: Für die Verwendung einzelner Bilder, die separat lizenziert sind, können Einschränkungen gelten.