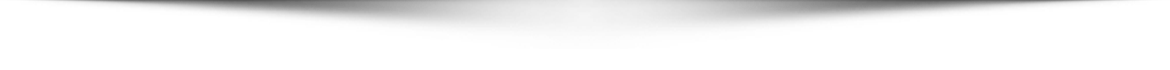Angels
Einführung
- 1 Weitere Informationen zu diesen Schriften und zu den Anfängen der ökofeministischen Bewegung finden Sie (…)
1Der Ökofeminismus entstand in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre weltweit aus der Verknüpfung von Forschung zu sozialer Gerechtigkeit und Umweltgesundheit. Zu dieser Zeit beleuchteten mehrere bahnbrechende Texte die Gemeinsamkeiten von Unterdrückungsstrukturen auf der Grundlage von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, Arten und Umwelt, insbesondere The Lay of the Land von Annette Kolodny und New Woman, New Earth: Sexistische Ideologien und menschliche Befreiung von Rosemary Radford-Ruether, die beide 1975 veröffentlicht wurden. Diesen Büchern folgten drei Jahre später Susan Griffin’s Woman and Nature: The Roaring Inside Her, und Mary Daly’s Gyn/Ecology: Die Metaethik des radikalen Feminismus. Dann, 1980, veröffentlichte Carolyn Merchant The Death of Nature: Women, Ecology and the Scientific Revolution.1
2Die Ideen von Mary Daly werden oft der radikalen Seite des Feminismus zugeordnet, obwohl sie eine klare Verbindung zwischen feministischem Denken und Umweltbewegung herstellte. Bereits in ihrem Titel legt Daly eine grenzwertige Reflexion über die Konzepte von Frauen und Ökologie offen. Indem sie an die Verfolgungen erinnert, unter denen Frauen in verschiedenen historischen Epochen und Kulturkreisen zu leiden hatten – wie das chinesische Fußbinden, die Genitalverstümmelung in Afrika oder die Hexenverfolgung in Europa -, unterstreicht sie die Existenz eines Zusammenhangs zwischen Umwelt- und weiblichen Gesundheitsproblemen. Daly lenkt die Aufmerksamkeit auch auf ein anderes Thema: die Sprache, ein Thema, das sie für weitaus heimtückischer und schwieriger zu entlarven hält, weil es allzu oft als fruchtloser Streit beiseite geschoben wird. Daly zeigt auf, was sie für die drei Facetten eines einzigen Problems hält: die von Männern dominierte Medikalisierung von Frauenkörpern, die Notwendigkeit, unsere Beziehungen zu Frauen wie auch zur Umwelt neu zu konzeptualisieren, und die Unvollkommenheit der Sprache, der Daly die Notwendigkeit einer gynozentrischen Ausrichtung der Sprache und des Denkens entgegensetzt.
3Im selben Jahr veröffentlichte Susan Griffin in einem etwas ähnlichen Geist Woman and Nature: The Roaring Inside Her. In einer Weise, die an Daly erinnert, brach Griffin mit dem traditionellen akademischen Stil und verfasste ein leidenschaftliches Prosagedicht, in dem sie die Heuchelei des westlichen industriellen Denkens in Bezug auf Frauen und die Umwelt entlarvt. Im Laufe des Buches paraphrasiert und verwebt die Autorin Texte ganz unterschiedlicher Herkunft wie gynäkologische Abhandlungen, forstwirtschaftliche Handbücher, Gedichte und wissenschaftliche Aufsätze mit ihren eigenen Texten. Das Ergebnis ist eine kraftvolle Anprangerung der seit dem Beginn des abendländischen Altertums verbreiteten Vorstellung, dass Frauen der Natur angeblich näher stehen und deshalb zwangsläufig, wie die Natur selbst, der männlichen Herrschaft unterworfen sind.
4Wie Daly geht Griffin die patriarchalischen Strukturen frontal an. Sie dekonstruiert die Stimme des Patriarchats von innen heraus und zeigt, wie sie voller Ausflüchte, Vorurteile und metaphysischer Unehrlichkeit sein kann. Auch hier greift die Autorin die Sprache an, die sie als Pfeiler des patriarchalischen Systems betrachtet. Durch die Entlarvung der Inkohärenzen des patriarchalen Diskurses und der Annahmen, die er durch die Sprache zu schaffen vermochte, enthüllt Frau und Natur die Absurdität und den Autoritarismus der diskursiven Assoziation, die dazu beitrug, alles unterzuordnen, was nicht in die Kategorie des „weißen Mannes“ passte. In ihrem Werk verwischt Griffin die traditionelle dualistische Kategorisierung durch eine vielstimmige Methode sowie durch die Natur des Buches selbst: teilweise akademische Abhandlung, Erzählung und Gedicht. Diese Eigenschaften sind sowohl die Stärke als auch die Schwäche dieses Werks.
5 Was mit diesem Buch geschah, ähnelt dem, was mit der ökofeministischen Bewegung als Ganzes geschah. Die Tatsache, dass das Buch nicht eindeutig als Essay, Roman oder Gedicht klassifiziert werden kann, sondern alles gleichzeitig ist, zwang den Leser, seine Beziehung zum Lesen und zu seinen Werkzeugen der kritischen Analyse zu überdenken. Es ist natürlich möglich, dieses Buch fragmentarisch zu studieren, indem man sich zum Beispiel nur auf seine poetische oder essayistische Seite konzentriert, aber dann fehlt etwas. Man sollte sich diesem Text auf eine transgenerische Weise nähern, und dasselbe gilt für die Bewegung, aus der er stammt. Diese allumfassende Perspektive verhinderte den Eintritt des Buches in akademische Kreise: Es wurde als nicht konventionell genug angesehen, als zu „radikal“ oder, schlimmer noch, als „essentialistisch“ betrachtet – weil es das Problem in der Runde behandelte – die Geschichte des Buches ist sehr repräsentativ für den Weg des Ökofeminismus.
6In einem völlig anderen, aber nicht weniger interdisziplinären Stil veröffentlichte Carolyn Merchant The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution im Jahr 1980. Die Autorin ist Professorin für Wissenschaftsgeschichte und Ethik an der Universität von Berkeley in Kalifornien. Merchant definierte die Aufklärung als die Zeit, in der die Wissenschaft begann, die Natur zu fragmentieren und zu sezieren. Sie behauptet, dies habe dazu geführt, dass die Natur als träge und leer angesehen wurde, als einfaches Gefäß, das bereit ist, die menschliche Kolonisierung zu empfangen, was an den weiblichen Körper erinnert, der oft als leeres Gefäß betrachtet wird, das auf den männlichen Samen wartet, um das Wunder des Lebens hervorzubringen. Durch die Verknüpfung von Studien des sozialen Feminismus und des Umweltschutzes ermöglicht Der Tod der Natur ein vollständiges historisches Panorama der Gründe, warum die Beherrschung der Frauen und die Ausbeutung der Natur gemeinsame Wurzeln im wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Rationalismus haben, der seit dem Mittelalter existiert.
7Merchants Werk mit seiner soliden historischen Dokumentation war damals der Ausgangspunkt für das, was heute als „materieller Feminismus“ bezeichnet wird. Obwohl ihre Ideen im Grunde analog sind, scheint es die Form zu sein, die Daly und Griffin ihren Arbeiten gegeben haben, die sich als problematisch erwiesen hat. Dies gilt insbesondere für Griffins Woman and Nature, das auf gründlicher historischer Forschungsarbeit und einer umfassenden Analyse historischer Daten beruht (ihre Quellen sind oft ähnlich wie die von Merchant). Leider wurde die Wirkung der von ihr verwendeten Daten dadurch untergraben, dass Griffins Schreiben nicht repräsentativ für das traditionelle Schreiben von Essays war. Sie machte sich die Subjektivität ihres Schreibens zum großen Teil zunutze, indem sie den Leser dazu brachte, das besprochene Unrecht nachzuempfinden, indem sie es im Schreibstil nachahmte. So entstand ein poetischer Text von großer Kraft, der aber auch das Verständnis für das Thema, das die Autorin behandelte, unterdrückte. Die Form des Buches ist so vielfältig und heterogen wie die Themen, die der Ökofeminismus behandelt, und einige seiner Verästelungen mögen etwas kultisch anmuten. Die wissenschaftlichen Arbeiten ökofeministischer Wissenschaftlerinnen aus verschiedenen Bereichen sowie fiktionale und nicht-fiktionale ökofeministische Erzählungen bilden jedoch eine solide Grundlage für ein transdisziplinäres ökofeministisches Forschungsfeld, auch wenn die Frage der Transdisziplinarität der eigentliche Zankapfel ist.
Nicht genug Winkel und zu viele „Linden“?
8 Wie Griffins Beispiel zeigt, wurde die Transdisziplinarität des Ökofeminismus von Anfang an als problematisch angesehen. Im Nachhinein zeigt sich, dass dieses Missverständnis nicht aus der Illegitimität oder Bedeutungslosigkeit der Bewegung resultierte, sondern aus ihrer Transdisziplinarität. Mit anderen Worten: Der Angriff auf die Transdisziplinarität des Ökofeminismus war Teil eines allgemeinen Versuchs, den ökofeministischen Ansatz als Ganzes zu disqualifizieren. So lehnte die Redaktion der Zeitschrift Signs im Juni 1992 einen Artikel über den Ökofeminismus mit folgender Begründung ab: „Der Ökofeminismus scheint sich mit allem in der Welt zu befassen, der Feminismus selbst scheint dabei fast ausgelöscht zu werden, wenn er alle Völker und alle Ungerechtigkeiten enthält, die Feinabstimmung und Differenzierung geht verloren“ (wiedergegeben in Gaard 1993: 32-3). Dieses Beispiel verdeutlicht, dass die Vielfalt der Ansätze und Anwendungen des Ökofeminismus ein Problem für die traditionellen Denkweisen darstellte.
9Ein paar Jahre später begann sich die ökofeministische Theorie jedoch weltweit zu festigen, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Mehrere bahnbrechende Sammelbände wurden veröffentlicht, der erste davon war Reclaim the Earth, herausgegeben von Leonie Caldecott und Stephanie Leland im Jahr 1983. Dieser erste wirklich transdisziplinäre Band ermöglichte es, die erstaunliche Vielfalt, die den Ökofeminismus ausmachte, zu erfassen:
Der Band von Caldecott und Leland überbrückte die spätere Trennung zwischen Theorie und Aktivismus, indem er sowohl Poesie als auch Wissenschaft und Arbeiten verschiedener Feministinnen, darunter Wangari Maathai (Kenia) über die Bewegung des Grünen Bandes, bot, Rosalie Bertell (Kanada) über Atomkraft und Gesundheit, Wilmette Brown (Großbritannien/USA) über die Ökologie der schwarzen Ghettos, Marta Zabaleta (Argentinien) über die Mütter der Plaza de Mayo, das Manushi-Kollektiv (Indien) über weibliche Kindermorde und Anita Anand (Indien) über den Chipko Andolan. (Estok et al. 2013: 29)
10Obwohl sie ähnliche Ziele verfolgen, funktionierten Theorie und Basisbewegungen bis dahin auf unterschiedliche Art und Weise. Reclaim the Earth war das erste Werk, das eine dauerhafte Verbindung zwischen den beiden Handlungsfeldern Aktivismus und Theorie herstellte. Zwei Artikel, die im gleichen Zeitraum veröffentlicht wurden, zeigen den „globalen Charakterzug“ der ökofeministischen Bewegung. In „Deeper than Deep Ecology: the Eco-Feminist Connection“ (1984) bietet die Australierin Ariel Salleh eine Erweiterung der Überlegungen der Deep Ecology-Bewegung, die sie für zu sehr auf den Menschen bezogen hält. Ihre Argumente zeigten auf, was ein kombinierter Ansatz von Umweltbewegung und Feminismus der Ökologie insgesamt bringen könnte, da er einen ethischeren Umgang mit allen Lebewesen ermöglichen würde, so Salleh. 1986 veröffentlichte die deutsche Soziologin Maria Mies „Patriarchat und Akkumulation im Weltmaßstab“, in dem sie die Theorie, die sie bisher nur auf ihre Studien über die Lebensbedingungen von Frauen in Indien angewandt hatte, weiter ausbaute. Sechs Jahre zuvor hatte Mies ein Buch veröffentlicht, in dem sie die Schwierigkeiten anprangerte, mit denen die indischen Frauen im Kampf gegen den äußerst aktiven patriarchalischen Geist des Landes konfrontiert waren (Mies 1980). Dieses Interesse an der Anwendung ökofeministischer Analysen auf das indische Land ermöglichte die Zusammenarbeit von Mies mit einer anderen bekannten Ökofeministin, Vandana Shiva.
11Diese beiden Artikel, die für die geografische Streuung ökofeministischer Wissenschaftlerinnen repräsentativ sind, ebneten auch den Weg für zwei weitere, die für die Bewegung entscheidend waren: „Ecofeminism: an overview and discussion of positions and arguments“ (1986) von Val Plumwood, und „Feminism and Ecology: Making Connections“ von Karen Warren. Beide Beiträge konzentrierten sich auf die Notwendigkeit, die Verbindungen zwischen Feminismus und Ökologie zu verstehen und begannen, ein kohärenteres ökofeministisches Denken zu etablieren. Dank dieser Arbeiten entwickelte Karen Warren später ihre „Logik der Herrschaft“ (Warren 1990: 126-132), die Val Plumwood als Theorie des „Meistermodells“ bezeichnete (Plumwood 1993: 23). Diese Ideen waren für den Ökofeminismus von zentraler Bedeutung, denn auf diese Weise wurden die Verbindungen, die vor allem im kapitalistischen Patriarchat zwischen Umweltzerstörung und Unterdrückung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit, sozialer Klasse oder sexueller Orientierung bestanden, durch eine ökologische und feministische Analyse sichtbar gemacht.
12Diese Analyse beleuchtete eine doppelte Beziehung zwischen der Natur und Frauen (oder anderen Wesen, die als „weibliche Andere“ betrachtet werden). Erstens scheinen Frauen in einem größeren Teil der Welt aufgrund der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die ihnen die Rolle des Versorgers auferlegt, stärker unter der Umweltzerstörung zu leiden. Die Tatsache, dass diese Frauen für die Beschaffung von Feuerholz, die Beschaffung von Wasser für das Haus, die Nahrungssuche usw. zuständig sind, führt dazu, dass sie die zunehmenden Zwänge der Umweltveränderungen am stärksten zu spüren bekommen (z. B. indem sie immer weitere Strecken für die Beschaffung von Holz und Wasser zurücklegen müssen). Diese Analyse wird durch Daten bestätigt, die in Women and Environment in the Third World (1988) von Joan Davidson und Irene Dankelman und in Staying Alive: Women, Ecology and Development (1989) von Vandana Shiva.
13Die andere Verbindung zwischen Frauen und Natur soll auf einer konzeptionellen Ebene bestehen. Diese Verbindung wurde auf sehr unterschiedliche Weise artikuliert, weshalb sie in ihrer Gesamtheit schwer zu erklären ist. Der Kern des Problems liegt angeblich in der hierarchischen und binären Denkweise westlicher bzw. westlich beeinflusster Gesellschaften. Diese begrifflichen Strukturen haben eine Vormachtstellung in der Art und Weise, wie die Welt wahrgenommen und organisiert wird. Binäre Strukturen schaffen Paare, in denen das eine gegenüber dem anderen immer begrifflich abgewertet ist. Darüber hinaus wird der abgewertete Partner fast immer als naturnäher und weiblicher wahrgenommen als die andere Hälfte des Paares (z. B. Vernunft/Emotion oder zivilisiert/wild). Diese binären Strukturen scheinen gerechtfertigt, manchmal sogar natürlich zu sein, während nach Ansicht der Ökofeministinnen eine Neubewertung unserer philosophischen und begrifflichen Wahrnehmung ein besseres Verständnis der Art und Weise ermöglicht, wie sie in Wirklichkeit sozial und kulturell konstruiert wurden und sich gegenseitig verstärken.
14 In den 1990er Jahren war der Ökofeminismus kein Feld mehr, das in den Kinderschuhen steckte, sondern eine kritische Theorie, die auf verschiedene Bereiche angewandt werden konnte, seien sie philosophisch, soziologisch oder semantisch. Unter dem Einfluss von Murray Bookchin begannen Janet Biehl und Ynestra King, einen „sozialen Ökofeminismus“ zu entwickeln, der dem, was heute als „Bioregionalismus“ bezeichnet wird, sehr nahe kommt. Im Jahr 1989 veröffentlichte Carolyn Merchant Ecological Revolutions. Nature, Gender and Science in New England; Barba Noske, Humans and Other Animals: Beyond the Boundaries of Anthropology und Judith Plant, Healing the Wounds: Das Versprechen des Ökofeminismus. Die ersten beiden zeichneten in klassischer essayistischer Manier die Entwicklung des ökofeministischen Denkens sowie das Bestreben der Bewegung nach, den Binarismus, um den es in den westlichen Gesellschaften traditionell geht, zu bekämpfen, um die miteinander verknüpften Herrschaftsmuster sichtbar zu machen. Damit führten diese Schriften fort, was die Arbeiten von Menschen wie Merchant, Plumwood, Salleh, Radford-Ruether und Mies begonnen hatten, indem sie zeigten, wie bereichernd eine Vision sein kann, die sich gemeinsam auf Geschlecht und Umwelt konzentriert.
15Die in den Jahren 1989 und 1990 veröffentlichten Anthologien haben die Bedeutung einiger ihrer Teilnehmerinnen bestätigt, deren Arbeiten schnell zu Grundpfeilern der ökofeministischen Bewegung wurden: Shiva (1988), Kheel (1988), King (1989), Spretnak (1982), Starhawk (1979, 1982) oder Radford Ruether (1983). Beide Werke boten Essays zur Dekonstruktion des binären Denkens sowie Gedichte, akademische Abhandlungen, philosophische Mythen und so weiter. Andere Werke verstärkten diese Ideen weiter, wie The Dreaded Comparison von Marjorie Spiegel (1988), The Rape of the Wild von Andrée Collard und Joyce Contrucci (1989), in den Fußstapfen von Kolodnys The Lay of the Land (1975). Indem sie sich auf die korrelativen Strukturen von Wissenschaft und Technik, von Militarismus und Jagd, von Sklaverei und Häuslichkeit konzentrieren, berichten Collard und Contrucci über die Art und Weise, wie Sprache, monotheistische Religionen und patriarchale Kulturen ein Verhältnis zur Welt legitimieren, das auf Herrschaft und Eroberung beruht, ja sogar darauf konstruiert ist.
Eine hinderliche ‚Allumfassendheit‘
- 2 Der kulturelle Ökofeminismus ist der spirituelle Zweig der Bewegung, der manchmal auch als Godde (…) bezeichnet wird
16Das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erlebte einen regelmäßigen Strom von Veröffentlichungen, die den Ökofeminismus sowohl stärkten als auch schwächten. Die Vielfalt der Standpunkte machte den Ökofeminismus zu einer Ideologie, die in ihrer Gesamtheit behandelt werden musste, was genau das war, was die Menschen, die sich anfangs für seine Ideen interessierten, entmutigte. Die wenigen Verfechter des so genannten „kulturellen Ökofeminismus „2 diskreditierten die gesamte Bewegung, indem sie sie als essentialistische Feier einer biologisch-natürlichen Verbindung zwischen Frauen und Natur erscheinen ließen:
Indem sie sich auf die Zelebrierung der Göttinnenspiritualität und die Kritik am Patriarchat konzentrierten, die im kulturellen Ökofeminismus vertreten wird, stellten poststrukturalistische und andere Feminismen der dritten Welle alle Ökofeminismen als eine ausschließlich essentialistische Gleichsetzung von Frauen und Natur dar und diskreditierten die Vielfalt der Argumente und Standpunkte des Ökofeminismus. (Gaard 1992: 32)
17Eine große Zahl von Schriften setzte jedoch fort, was die Arbeiten des vorangegangenen Jahrzehnts begonnen hatten, nämlich die Verurteilung der Assoziation zwischen Frauen, Weiblichkeit und Natur und deren Entlarvung als Ergebnis einer sozialen Konstruktion. Akademische Arbeiten erbrachten den Nachweis, dass diese sozialen Konstruktionen ebenso wie die Gesellschaft, der sie entstammen, kontextuell verankert und beweglich sind und nicht ahistorisch und starr, wie es kulturelle Ökofeministen behaupten. Ausgehend von einem neuen materialistischen Standpunkt haben Denkerinnen wie Lori Gruen (1993), Donna Haraway (1991) und Irene Diamond (1994) die Strukturierung der konzeptionellen Verbindung zwischen Frauen und Natur analysiert. Damit ging die ökofeministische Theorie der 1990er Jahre einen Schritt weiter, indem sie nicht nur die verschiedenen Verbindungen zwischen unterdrückerischen Strukturen aufzeigte, sondern auch die Struktur der Unterdrückung selbst in den Mittelpunkt ihrer Analyse stellte.
- 3 Der Begriff „Speziesismus“ wird in der Regel verwendet, um sich auf die „menschliche Vorherrschaft“ zu beziehen: die Idee, nach der (…)
18 Alle diese Forschungen weisen auf die Tatsache hin, dass es eine einzige Logik der Beherrschung gibt, die in analoger Weise auf verschiedene Gruppen angewandt wird, die entsprechend den dualistischen Unterscheidungen identifiziert werden, auf denen das euro-amerikanische patriarchalische kapitalistische Denken beruht. Diese Logik der Herrschaft war der Kern des Kolonialismus, des Rassismus, des Sexismus und dessen, was heute als „Speziesismus“ oder „Naturismus“ bezeichnet wird.3 Da all diese Formen der Unterdrückung durch die ihnen zugrunde liegende Konzeptualisierung verbunden sind, fordern Ökofeministinnen, dass Themen wie Feminismus, Umweltschutz, Antirassismus usw. gemeinsam bekämpft werden sollten:
Ökofeministinnen bestehen darauf, dass die Art von Herrschaftslogik, die verwendet wird, um die Beherrschung von Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Klassenstatus zu rechtfertigen, auch zur Rechtfertigung der Beherrschung der Natur verwendet wird. Da die Beseitigung einer Logik der Beherrschung Teil einer feministischen Kritik ist – sei es eine Kritik des Patriarchats, der weißen Vorherrschaftskultur oder des Imperialismus – bestehen Ökofeministinnen darauf, dass Naturismus zu Recht als integraler Bestandteil jeder feministischen Solidaritätsbewegung zur Beendigung der sexistischen Unterdrückung und der Logik der Beherrschung, die ihr konzeptionell zugrunde liegt, betrachtet wird. Da diese Verbindungen zwischen Sexismus und Naturismus letztlich konzeptionell sind – eingebettet in einen unterdrückerischen konzeptionellen Rahmen – führt die Logik des traditionellen Feminismus dazu, den ökologischen Feminismus zu umarmen. (Warren 1990: 130)
19Dies ist nach Karen Warren einer der Gründe, die dazu dienen, den gemeinsamen Kampf von Umweltbewegung und Feminismus in Form des Ökofeminismus zu rechtfertigen. Ein weiterer Grund liegt in der Art und Weise, wie Geschlecht und Natur in der westlichen patriarchalischen Gesellschaft konzeptualisiert wurden:
Gleich wie die Vorstellungen von Geschlecht sozial konstruiert sind, so sind es auch die Vorstellungen von Natur. Die Behauptung, dass Frauen und Natur soziale Konstruktionen sind, setzt natürlich nicht voraus, dass jemand leugnet, dass es tatsächliche Menschen und tatsächliche Bäume, Flüsse und Pflanzen gibt. Sie impliziert lediglich, dass die Art und Weise, wie Frauen und Natur aufgefasst werden, eine Frage der historischen und sozialen Realität ist. Diese Vorstellungen variieren kulturübergreifend und je nach historischer Epoche. Folglich bezieht sich jede Diskussion über die „Unterdrückung oder Beherrschung der Natur“ auf historisch spezifische Formen der sozialen Beherrschung der nicht-menschlichen Natur durch den Menschen, so wie sich die Diskussion über die „Beherrschung der Frau“ auf historisch spezifische Formen der sozialen Beherrschung der Frau durch den Mann bezieht. beinhaltet, dass innerhalb des Patriarchats die Feminisierung der Natur und die Naturalisierung der Frau entscheidend für die historisch erfolgreiche Unterordnung beider waren. (Warren 1990: 131)
20Trotz der scheinbar soliden theoretischen Fundierung ökofeministischer Ideen kam es jedoch zu ernsthaften Auseinandersetzungen mit dem Vorwurf des Essentialismus. Einige Autorinnen wurden als „gefährlich“ eingestuft, weil ihre Arbeiten als zu universalisierend galten oder weil sie die Idee zu vertreten schienen, es gäbe eine universelle weibliche Natur oder eine biologisch determinierte Weiblichkeit.
21Die genauen Punkte der Kontroverse um die essentialistische Ausrichtung des Ökofeminismus sind so komplex geworden, dass eine Wiederholung jeder Einzelheit der Kontroverse vom Zweck dieser Arbeit ablenken würde. In dem Bemühen, die essentialistischen Vorwürfe abzuwehren, haben zahlreiche feministische und ökofeministische Wissenschaftlerinnen den Ökofeminismus im Allgemeinen heruntergemacht. In „Ecofeminism Revisited: Rejecting Essentialism and Re-Placing Species in a Material Feminist Environmentalism“ bietet Greta Gaard eine interessante Synthese der verschiedenen Diskussionen über den angeblichen Essentialismus einiger ökofeministischer Ansätze der 1990er Jahre. In einem weiteren Artikel, „Misunderstanding Ecofeminism“, erläutert sie, wie die wiederholten Angriffe, denen der Ökofeminismus ausgesetzt war, ihrer Meinung nach auf ein Missverständnis zurückzuführen sind:
Die Weigerung, den Ökofeminismus innerhalb der Kreise des standardisierten feministischen Diskurses ernst zu nehmen, hat zwei Formen angenommen: erstens, der Ökofeminismus ist falsch; zweitens, der Ökofeminismus wird nicht ernst genommen, weil dies ein Überdenken der gesamten Struktur des Feminismus erfordern würde. Da diese Erklärungen sich gegenseitig ausschließen, können sie nicht beide wahr sein. Es ist erwähnenswert, dass die gleichzeitige Behauptung, zwei widersprüchliche Überzeugungen seien wahr, eine Art von Doppeldenk ist, das für Unterdrückungssysteme charakteristisch ist und dazu dient, die Unterschicht durch Paradoxie zu lähmen. Dass der etablierte Feminismus diese Strategie nun anwendet, ist ein Beweis für den hegemonialen Status, den der Feminismus erreicht hat – und daher ein Zeichen der Vorsicht, wie viel Glaubwürdigkeit er haben sollte. Der Ökofeminismus gilt im Allgemeinen als „falsch“, weil Kritiker die Theorie als Prämisse für die Verbindung von Frau und Natur dargestellt haben: Aber dieser Vorwurf kann nur durch einfaches Missverständnis, schiere Unwissenheit oder vorsätzliche Falschdarstellung erhoben werden (Gaard 1992: 21)
- 4 Um nur einige zu nennen: Marxistisch, liberal, liberal egalitär, postmodern, radikal, materialistisch, radikal (…)
22Wenn man den Vorwurf des Essentialismus, dem der Ökofeminismus ausgesetzt war, in den größeren historischen Kontext der feministischen Bewegungen der letzten fünfzig Jahre einordnet, stellt man fest, dass innerhalb der feministischen Denkströmungen, aus denen der Ökofeminismus entstand, eine ähnliche Debatte geführt wurde. Unter den vielen Zweigen des Feminismus4 werden einige Strömungen als „differenziell“ oder „kulturell“ bezeichnet, da sie von einer biologisch determinierten Natur ausgehen (im Gegensatz zu dem von anderen Feminismen vertretenen sozialkonstruktivistischen Standpunkt) und für eine notwendige Anerkennung einer weiblichen Lebenserfahrung eintreten.
23Obwohl allgemeinere feministische Bewegungen diese Ideen immer wieder abgelehnt haben, müssen sie berücksichtigt werden, wenn man versucht, feministische Bewegungen im Allgemeinen historisch zu kontextualisieren – und sei es nur, um anzuerkennen, dass sie nur ein kleiner Teil eines viel größeren Ganzen sind und dass sie keineswegs an dessen Stelle treten sollten. Es ist wichtig zu bedenken, dass das Gleiche für die Ideen des kulturellen Ökofeminismus gilt, der nur einen kleinen Teil einer größeren Bewegung darstellt. So wie man nicht alle Formen des Feminismus unter dem Vorwand ablehnen kann, dass einige seiner Zweige differenziell oder kulturell sind, kann man auch nicht die Gesamtheit der ökofeministischen Ideologien allein deshalb ablehnen, weil einige ihrer Verfechterinnen ihre Prämissen auf die „Existenz einer vorausgesetzten Verbindung“ (Brugeron 2009: 1) zwischen dem „Öko“ und dem „Weiblichen“ stützen, die die Natur und die biologischen Eigenschaften der Frauen miteinander verbindet.
24Die Verwendung spezifischer Merkmale eines ausgeprägten kulturellen oder spirituellen Zweigs einer Bewegung, um diese als inhärente Eigenschaften der allgemeineren Denkströmung darzustellen, ist ein Vorgehen, das selbst als essentialistisch bezeichnet werden könnte, da es darauf hinausläuft, „den Teil für das Ganze zu verwechseln“ (Gaard 1992: 21). So scheint es, dass die meisten der feministischen Bewegungen, die den Ökofeminismus in seiner Gesamtheit wegen der Verquickung von Teil und Ganzem ablehnten, in Wirklichkeit dasselbe patriarchale Systemdenken anwandten, das sie von Anfang an zu bekämpfen versuchten.
25Dies veranschaulicht, was die ökofeministische Bewegung den feministischen und umweltpolitischen Bewegungen vorwirft: Sie reproduzieren genau die dualistische Denkstruktur (und damit auch die zugrunde liegende Herrschaftslogik), die sie in patriarchalen und anthropozentrischen Systemen zu bekämpfen beabsichtigen. Diese Reproduktion der „wert-hierarchischen Dualitäten“, ein von Warren (1993: 255) verwendeter Begriff, imitiert die von den meisten feministischen Bewegungen abgelehnten Dichotomien wie Körper/Geist, Frau/Mann, Emotion/Vernunft usw., die von ökofeministischen Wissenschaftlerinnen auf andere dualistische Strukturen wie Natur/Kultur, weiß/nicht-weiß, menschlich/nicht-menschlich usw. ausgedehnt wurden. Folgt man u.a. den Theorien von Warren und Plumwood, wonach die Einordnung in die eine oder andere Kategorie eine begriffliche Verschmelzung der verschiedenen Komponenten dieser Dichotomien bewirkt, so führt die essentialistisch-konstruktivistische Dichotomie zur Diskreditierung der gesamten ökofeministischen Bewegung, da sie dann mit dem Natürlichen (eine Kategorie, die allgemein beschimpft wird) im Gegensatz zum Kulturellen in Verbindung gebracht wird.
26 Genauso wie eine ausschließlich sozialistische oder feministische Analyse als reduktionistisch angesehen werden könnte, da sie nur eine Seite einer Frage behandelt, die offensichtlich verschiedene Facetten hat, müssen wir uns angesichts der aktuellen sozialen und ökologischen Krise fragen, ob die essentialistische/konstruktivistische Dichotomie als Ansatz für den Ökofeminismus legitim bleibt. Diese Frage wurde bereits 1989 von Diana Fuss in ihrem Buch Essentially Speaking: Feminism, Nature & Difference (Feminismus, Natur & Differenz) aufgeworfen, aber die Bedeutung von Fuss‘ Ideen wurde durch den Aufruhr der Angst, den das Wort „essentialistisch“ um die ökofeministische Bewegung auslöste, hinweggefegt. Fuss plädierte für einen Rückzug aus dem Gegensatz zwischen Essentialismus und Konstruktivismus, weil sie darin die Wurzel vieler negativer Reaktionen in Bezug auf Feminismus und Ökofeminismus in den letzten Jahrzehnten sah: „Es kann auch behauptet werden, dass dieser gleiche Streit die gegenwärtige Sackgasse im Feminismus geschaffen hat, eine Sackgasse, die auf der Schwierigkeit beruht, das Soziale im Verhältnis zum Natürlichen oder das Theoretische im Verhältnis zum Politischen zu theoretisieren“ (Fuss 1990: 1).
27Das Problem, das diese Dichotomie aufwirft, liegt ihrer Meinung nach nicht in der eigentlichen essentialistischen Qualität einer Idee, sondern in dem Verdacht des Essentialismus, der die Verfolgung der Analyse völlig lähmt:
Wenige andere Wörter im Vokabular der zeitgenössischen kritischen Theorie werden so hartnäckig verleumdet, so wenig hinterfragt und so vorhersehbar als Begriff der unfehlbaren Kritik beschworen. Die schiere rhetorische Kraft des Essentialismus als Ausdruck der Missbilligung und Verunglimpfung wurde mir vor kurzem im Unterricht vor Augen geführt, als eine meiner theoretisch versiertesten Studentinnen mit dem ganzen Gewicht der neueren feministischen Theorie im Rücken versuchte, mich davon zu überzeugen, dass der marxistisch-feministische Text, den ich zugewiesen hatte, unsere ernsthafte Betrachtung nicht verdiene. Meine Antwort auf den Vorwurf dieser Studentin könnte auch als Leitmotiv für dieses Buch dienen: An und für sich ist der Essentialismus weder gut noch schlecht, weder fortschrittlich noch reaktionär, weder nützlich noch gefährlich. Die Frage, die wir uns stellen sollten, lautet nicht: „Ist dieser Text essenzialistisch (und damit ’schlecht‘)?“, sondern vielmehr: „Wenn dieser Text essenzialistisch ist, was motiviert seine Verwendung?“ Wie zirkuliert das Zeichen „Essenz“ in den verschiedenen zeitgenössischen kritischen Debatten? Wo, wie und warum wird es beschworen? Was sind seine politischen und inhaltlichen Auswirkungen? Dies sind meiner Meinung nach die interessanteren und letztlich auch die schwierigeren Fragen. (Fuss xi)
28Zusammenfassend lässt sich sagen, dass, wenn man ökofeministische Theorien als stillschweigendes Bekenntnis zu einer biologischen Verbindung zwischen Frauen und Natur versteht, die Bewegung natürlich sowohl einer Veränderung des Status der Frauen als auch einer Entwicklung der missbräuchlichen Ausbeutung der Natur in den westlichen Industriegesellschaften abträglich erscheinen könnte. Anstatt sich jedoch von den neuen Theorien unter dem Vorwand abzuwenden, dass einige ihrer Verfechter möglicherweise essentialistische Ideen vertreten, wäre es vielleicht interessanter, die Frage aus einer kritischen Perspektive zu stellen, um zu wissen, ob dieser Essentialismus für die notwendige Erneuerung unserer Weltanschauungen von Interesse sein könnte. Wenn die Antwort nein lautet, dann hätten wir einen guten Grund, uns nicht für die Ideen zu interessieren, die in diesen Texten zum Ausdruck kommen. Wenn aber die geringste Möglichkeit besteht, dass die Antwort ja lautet („ja, sogar diese essentialistischen Texte könnten für die Erneuerung unserer Weltanschauungen von Interesse sein“), riskieren wir dann nicht, ein wichtiges Element zu verlieren, indem wir eine ganze Denkströmung ablehnen, nur weil es in ihrer Mitte ein paar „Freigeister“ gibt? Angesichts der Feindseligkeit, mit der der Ökofeminismus aufgenommen wurde, schien es in der Tat so, als ob die akademische Welt bereit war, das Risiko einzugehen, wichtige Elemente des ökofeministischen Denkens zu verlieren, kurz gesagt, es schien, als ob die akademische Welt bereit war, das Kind mit dem Bade auszuschütten.
Wenn Literatur Wiedergutmachung erlaubt
29Im Jahr 1998 gaben Patrick D. Murphy und Greta Gaard gemeinsam den Band Ecofeminist Literary Criticism: Theory, Interpretation, Pedagogy, eine erweiterte Version der Sonderausgabe, die sie 1996 zum gleichen Thema für die Zeitschrift ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment herausgegeben hatten. Diese Konvergenz von aktivistischen und literarischen Theorien bot eine Vielfalt von Analysen, die aus der feministischen ökologischen Geschichte schöpften, um die Möglichkeiten einer ökofeministischen Literaturkritik zu vervielfachen. Im Gegensatz zu anderen theoretischen Arbeiten, die die problematische „essenzialistische“ Seite des kulturellen Ökofeminismus ausblenden, gehen die beiden Herausgeberinnen auf die breite Vielfalt der Standpunkte innerhalb der Bewegung ein und verweisen bereits im Vorwort des Buches auf diese Probleme, die sich für den kulturellen Ökofeminismus ergeben haben. Die Herausgeberinnen sind jedoch nicht der Meinung, dass diese Probleme abgetan werden sollten, um den Rest der Bewegung besser zu verstehen, sondern betonen, dass die Vielfalt ein notwendiger Bestandteil innerhalb der ökofeministischen Bewegung ist, der nicht wegen einiger divergierender Standpunkte verworfen werden sollte.
30Die Literaturkritik, die sich seither aus der ökofeministischen Gesellschaftstheorie entwickelt hat, war aus verschiedenen Gründen von besonderer Bedeutung: Zum einen bot sie die Möglichkeit, die oben erwähnten fruchtlosen Essentialismus-Debatten hinter sich zu lassen, und, was noch wichtiger ist, sie warf jene Fragen auf, die, so Diana Fuss, unsere kritischen Ansätze umfassender und damit geeigneter für eine neue Art, die Welt zu bewohnen, machen könnten. Während eine wachsende Zahl von WissenschaftlerInnen sich vom Ökofeminismus abzuwenden schien – oder zumindest die Verwendung des Begriffs zu vermeiden schien, um nicht in Verruf zu geraten -, ermöglichte diese neue Verwendung ökofeministischer Theorien eine Rückkehr der Bewegung als Ganzes in die Gunst. Obwohl die enorme Vielfalt der möglichen Ansätze und Verwendungen einige dazu veranlasst hatte, das Ende des Ökofeminismus vorherzusagen, wurde die Wende zum 21. Jahrhundert Zeuge einer bisher unerforschten Verwendung.
31Auch wenn Gaard und Murphy am Anfang der so genannten „ökofeministischen Literaturkritik“ standen und die ersten waren, die den Ökofeminismus als neues Mittel der kritischen Literaturanalyse einsetzten, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass sowohl Annette Kolodny (1975, 1984) als auch Susan Griffin (1978) bereits Literaturanalysen vorgelegt hatten, die den Ökofeminismus als Ausgangspunkt hatten.
32Es stimmt, dass die Literatur sozusagen einen geschlossenen Bereich bietet, in dem es möglich ist, ökofeministische Theorien in einer Weise umzusetzen, die unserem kritischen Geist weniger problematisch erscheint. Bei der Anwendung auf die Literatur werden die Winkel der Kategorien, mit denen unser Verstand arbeitet, weniger in die Liminalität gerissen als bei der Anwendung auf die praktische Sozialphilosophie des Ökofeminismus. In Anbetracht des eingeschränkten Anwendungsbereichs – sei es für die ökofeministische Literatur oder die Literaturkritik – scheint es einfacher zu sein, diese Ideen zu akzeptieren, wenn sie sich auf einen Text beziehen, als wenn sie sich auf eine globale Weltsicht beziehen. Die Subjektivität (das Wort sollte uns nicht zittern lassen), die ins Spiel kommt (sei es beim Schreiben oder bei der Analyse eines Textes, oder sogar bei der bloßen Auswahl eines Textes), erlaubt es, ökofeministische Ideen auf weniger problematische Weise zu akzeptieren. Es geht nämlich um die Wahrnehmung der Welt durch einen Autor. Als solche kann sie als weniger umstritten angesehen werden, da die Akzeptanz dieser Worte als wahr, genau oder wertvoll dann zu einer subjektiven, persönlichen Frage wird. Die Analyse eines Textes ermöglicht es einerseits, die Annäherung an die ökofeministische Bewegung zu vereinfachen, und andererseits, die Ideen des Ökofeminismus besser zu verstehen:
Die Literatur wird in unserer Gesellschaft per definitionem dazu benutzt, das Theoretische in die Praxis umzusetzen, die komplexe Philosophie durch die Vorstellungskraft in konkrete Erfahrungen zu verwandeln. Da der Ökofeminismus eher eine Lebensweise als eine Theorie sein will, scheint die Literatur ein natürliches Medium für die Verbreitung seiner Ideen und Praktiken zu sein. Indem die Lehren des Ökofeminismus in die Literatur aufgenommen werden, können die Menschen Wege für Diskussionen entdecken, die zur praktischen Anwendung der Theorien führen. Der erste Schritt besteht jedoch darin, die Menschen für die Probleme und die Verflechtung des Lebens, für Ursache und Wirkung und für die Notwendigkeit, persönliche Verantwortung für die Folgen unseres Handelns zu übernehmen, zu sensibilisieren. (Bennett 2012: 10)
Literatur als Ausgangspunkt für eine neue Transdisziplinarität
- 5 Siehe z.B. die Werke von Brenda Peterson, Linda Hogan, Terry Tempest Williams, Margaret Atwo (…)
33Die Schaffung literarischer Geschichten, die ökofeministische Ideen enthielten, florierte5 , während die Theorie, die versuchte, die gesellschaftskritische Bewegung zusammenzuhalten, Probleme zu haben schien. Die Auseinandersetzungen, die innerhalb der ökofeministischen Bewegung wegen des Problems der Sprache und der Dichotomien, die sie immer wieder transportiert, tobten, führten dazu, dass sich einige ihrer Verfechterinnen unter verschiedenen neuen Bezeichnungen zerstreuten: materieller Feminismus, Queer-Ökologie, feministischer Umweltismus, globale feministische Umweltgerechtigkeit usw. Auch wenn sich ihr methodischer Ansatz leicht von dem unterscheidet, mit dem die ökofeministische Theorie begann, ist es wichtig festzuhalten, dass die Kernideen unverändert geblieben sind. Ihr Hauptziel ist nach wie vor die Konzentration auf die Verflechtung unterdrückerischer und diskriminierender Strukturen in Bezug auf soziale Klasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Umweltgerechtigkeit oder Beziehungen zwischen den Arten, um die Systeme der Unterdrückung und Kategorisierung zu verurteilen, die den Kern der heutigen sozialen und ökologischen Krise bilden. Wenn es einen Bereich gibt, in dem der Ökofeminismus trotz der offensichtlichen Verstreuung seiner ursprünglichen Anhänger weiter existiert, dann ist es das literarische Umfeld, das sich um ihn herum entwickelt hat und in dem er sich selbst verstärkt hat, um von der akademischen Welt und den akademischen Kreisen ernst genommen zu werden, beginnend in den Vereinigten Staaten, auch dank der Tatsache, dass eine große Anzahl seiner Autoren und Verfechter auch als Lehrer tätig sind. Durch die Vermeidung der Gesellschaftstheorien des Ökofeminismus als Einstiegspunkt in die Bewegung entzieht sich das literarische Umfeld des Ökofeminismus den essentialistischen Kontroversen, die die theoretische Seite betrafen:
Anstatt Binaritäten einfach zu kritisieren oder umzukehren, schafft die affektive Narration eine Grundlage für eine Neudefinition des Menschlichen; die Fokussierung auf Erfahrungen, die eine komplexe Interaktion zwischen Geist und Körper oder zwischen Mensch und Umwelt beinhalten, zerstört die Illusion ihrer Trennung und ermöglicht Überlegungen zur menschlichen Teilhabe an dynamischen Beziehungen mit der nichtmenschlichen Natur. (Estok et al. 2013: 11)
34Als junge Wissenschaftlerin, die sich mit Ökofeminismus beschäftigt, habe ich eine wichtige Veränderung in meinem eigenen Forschungsbereich, nämlich den amerikanischen und anglophonen Studien, erlebt. Meine Arbeit wurde nicht mehr als etwas völlig Fremdes und potenziell Gefährliches angesehen, sondern als ein neues Modethema, als das nächstbeste. Dieser neu gefundene Erfolg wird durch die Tatsache bestätigt, dass ökofeministische Texte (wenn auch langsam) in den akademischen Korpus eindringen, oder durch aufregende neue Projekte wie die neue Sammlung „Sorcières“ des Cambourakis-Verlags, die zeigt, wie Literatur bei der Verbreitung von Ideen hilfreich sein kann. Zahlreiche Konferenzen und internationale Symposien haben sich mit Themen der Ökokritik, der feministischen Ökokritik und damit auch des Ökofeminismus befasst – und es werden weitere organisiert. Der Ökofeminismus kann als ein vielversprechendes transdisziplinäres kritisches Instrument betrachtet werden, das auf literarischer, sozialer und ökologischer Ebene weiterhin auf der Pluralität der Blickwinkel und der Liminalität der Zeiträume besteht, damit die Forschung die kulturelle und biologische Vielfalt des Planeten vollständig repräsentiert.